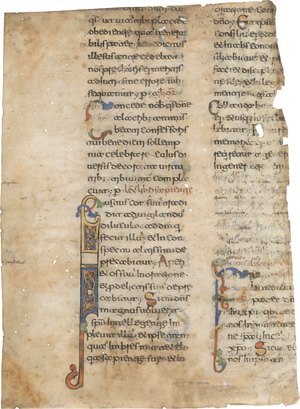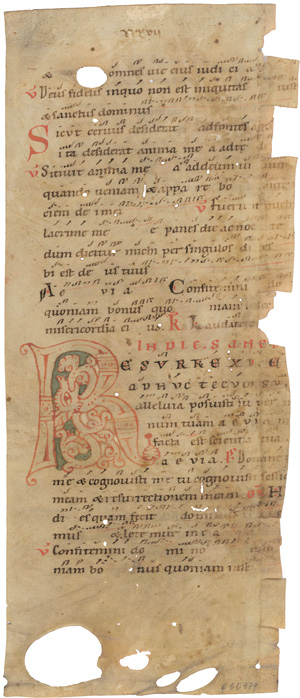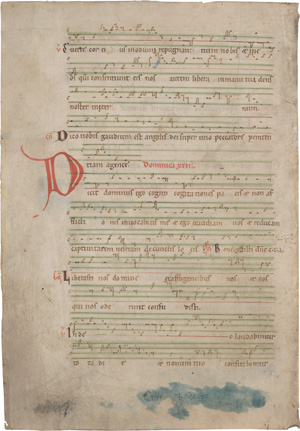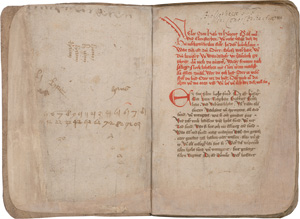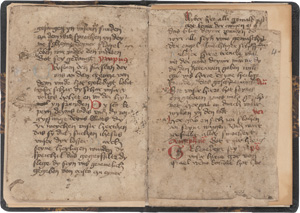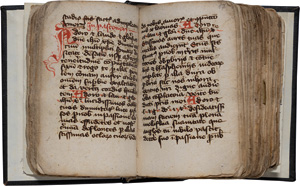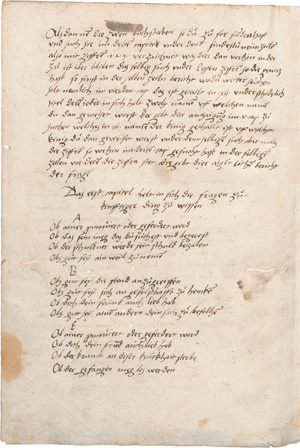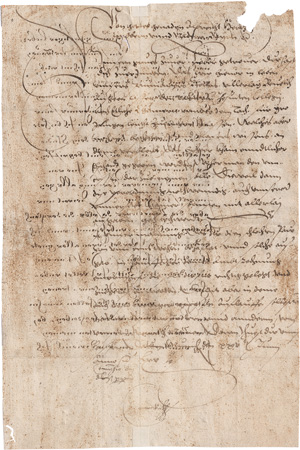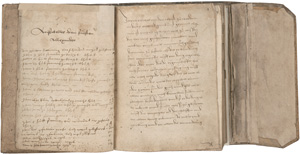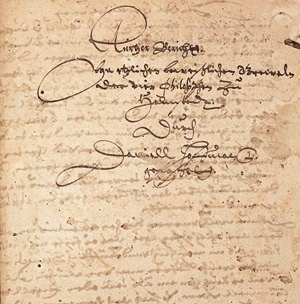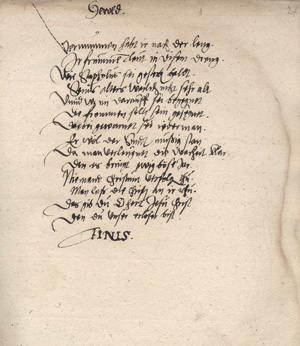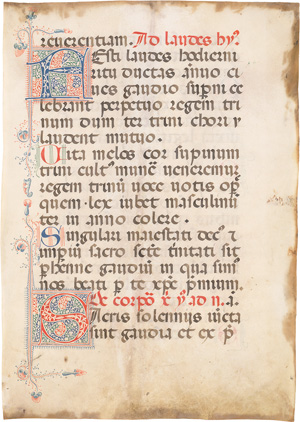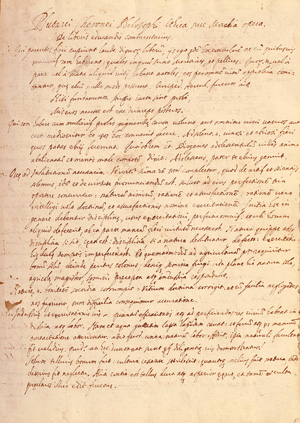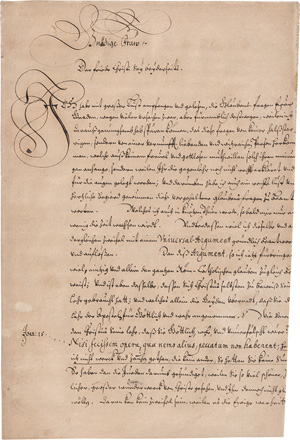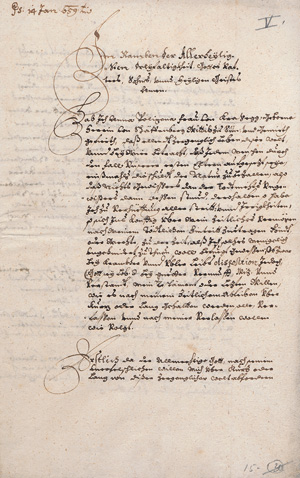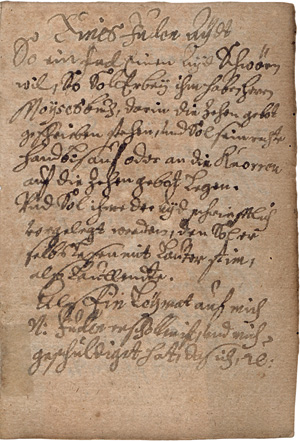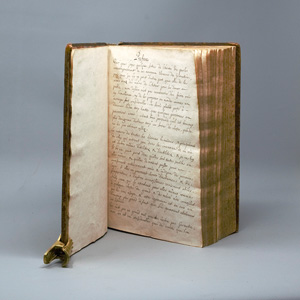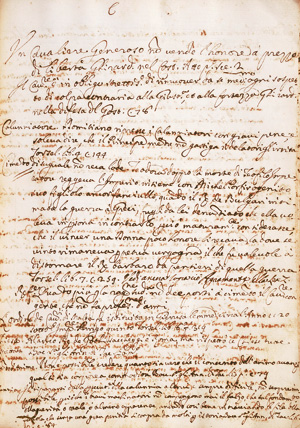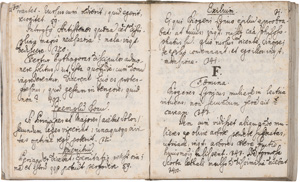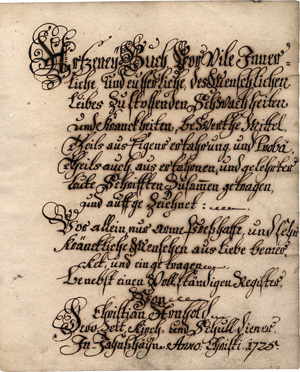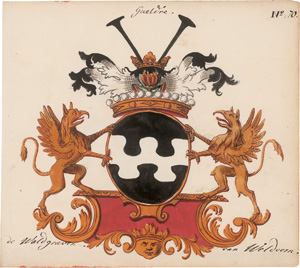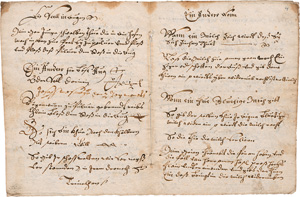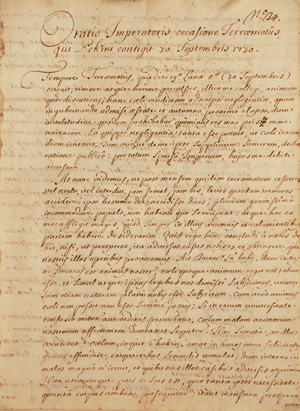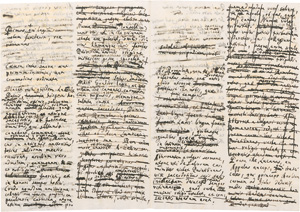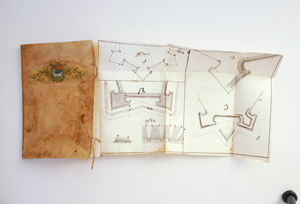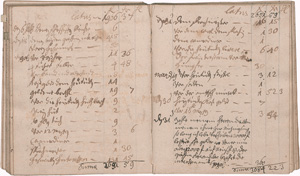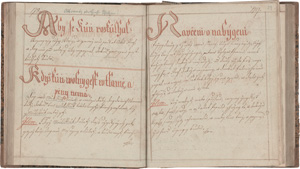Beneventana
Fragment eines süditalienischen Chrogebet-Brevier
Nachverkaufspreis
5.000€ (US$ 5,556)
Resurrexi
Großes Fragment aus einem Gregorianischen Messbuch
Nachverkaufspreis
2.000€ (US$ 2,222)
Neumenhandschrift
"Si iniquitates domine". Einzelblatt aus einem Antiphonar
Nachverkaufspreis
2.500€ (US$ 2,778)
Laudes salvatori
Einzelblatt aus einer lateinischen Choralhandschrift
Nachverkaufspreis
1.800€ (US$ 2,000)
Katechetische Sammelhandschrift
Deutsche Handschrift auf Papier. Südwestdeutschland um 1400
Nachverkaufspreis
40.000€ (US$ 44,444)
Passionalsbrevier
Umfangreiches Fragment aus einer spätmittelalterlichen Gebetshandschrift
Nachverkaufspreis
1.600€ (US$ 1,778)
Johannes von Neumarkt
Mystische Sammelhandschrift. Deutsche Handschrift auf Papier. Nürnberg, St. Katharina, 2. Drittel des 15. Jahrhunderts. - Umfangreiche spätmittelalterliche Sammelhandschrift
Nachverkaufspreis
24.000€ (US$ 26,667)
Geomantia
Eyn kunst des warsagens. Deutsche Handschrift auf Papier. Süddeutschland, frühe Mitte des 16. Jahrhundert
Nachverkaufspreis
600€ (US$ 667)
Eleazar und der verlorene Sohn
Fragmente aus zwei biblischen Erzählungen. Deutsche Handschrift auf Papier. Süddeutschland (Zell?) 1542 und 1545.
Nachverkaufspreis
1.000€ (US$ 1,111)
Weinmeister, Georg
Zwei Briefe an den Ingolstädter Zöllner Georg Weinmaister
Nachverkaufspreis
200€ (US$ 222)
Rosarium philosophorum
Alchemistische Sammelhandschrift. Deutsche Handschrift auf Papier.
Nachverkaufspreis
18.000€ (US$ 20,000)
Hoffmann, Daniel
Kurtzer Bericht von etlichen beweißlichen der vier Philosophen zu Helmstedt
Nachverkaufspreis
800€ (US$ 889)
Dialogus oder gesprech von dem absterben
Friderici Staphyli. Deutsche Handschrift auf Papier. Um 1600. - Abschrift
Nachverkaufspreis
180€ (US$ 200)
Ad Laudes hymnus
2 Einzelblätter aus einer großen Antiphonale-Handschrift. Italien um 1620. Mit mehreren Initialen
Nachverkaufspreis
200€ (US$ 222)
Conrad, Balthasar
Traktat von der Glaubwürdigkeit und Unverfälschtheit der katholischen Lehre. Deutsche Handschrift auf Papier
Nachverkaufspreis
240€ (US$ 267)
Testament
der Anna Polixena von Krasseg. Schloss Krasseg (Steiermark) 1659
Nachverkaufspreis
200€ (US$ 222)
Hostauer Judeneid
Deutsche Handschrift auf Papier. 7 S. auf 4 Bl. 14-18 Zeilen
Nachverkaufspreis
1.800€ (US$ 2,000)
Arnauld, Antoine
Nouveaux Elemens de Geometrie. Frankreich 1667. - Sehr saubere und klare Abschrift der wohl ersten Ausgabe.
Nachverkaufspreis
1.000€ (US$ 1,111)
Arnhold, Christian
Artzeney Buch Vor vile Jinnerliche, und eusserliche, des
Nachverkaufspreis
250€ (US$ 278)
Liebenberg
"Sammlung fürstlicher und adeliger Wappen". Deutsche Handschrift auf Papier. Um 1728
Nachverkaufspreis
3.000€ (US$ 3,333)
Rossarznei und geistliches Lied
Deutsche Handschrift auf Papier. Deutschland 1728
Nachverkaufspreis
220€ (US$ 244)
Oratio Imperatoris
occasione Terraemotus Pekini - Lat. Handschrift
Nachverkaufspreis
500€ (US$ 556)
Vitalis, Marineoffizier
Journal de la campagne que l'escadre des huit galères du Roy viennent de faire, présenté à Monseigneur le duc d'Anville. Marseille 1734
Nachverkaufspreis
2.000€ (US$ 2,222)
Römische Geschichte
Lateinisches Manuskript zur römischen Geschichte. Handschrift in schwarzbrauner Sepiatinte auf Papier. Italien Mitte 18. Jahrhundert
Nachverkaufspreis
300€ (US$ 333)
Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban
Breve Istruzione per l’intelligenza della Fortificazione Moderna
Nachverkaufspreis
500€ (US$ 556)
Neuschloß
Kontorbuch aus der Kaunitz-Bibliothek Neuschloß. Deutsche Handschrift auf Papier
Nachverkaufspreis
500€ (US$ 556)
Meister Albrant
"Albrechts Roßarzneibuch, Rosenberger Pelzbuch"
Nachverkaufspreis
500€ (US$ 556)
[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.
* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.
Galerie Bassenge
Erdener Str. 5A
14193 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,
Freitag, 10–16 Uhr
Telefon: +49 30 8938029-0
Fax: +49 30 8918025
E-Mail: info (at) bassenge.com
Impressum
Datenschutzerklärung
© 2024 Galerie Gerda Bassenge
Galerie Bassenge
Erdener Str. 5A
14193 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,
Freitag, 10–16 Uhr
Telefon: +49 30 8938029-0
Fax: +49 30 8918025
E-Mail: info (at) bassenge.com
Impressum
Datenschutzerklärung
© 2022 Galerie Gerda Bassenge