Los 6002
Auktion 122
Flämisch - Schule
um 1560/80. Die Beweinung Christi
Ergebnis (inkl. Aufgeld) *
42.500€ (US$ 48,295)
Aus dem Katalog
Gemälde Alter und Neuerer Meister
Auktionsdatum 30.11.2023
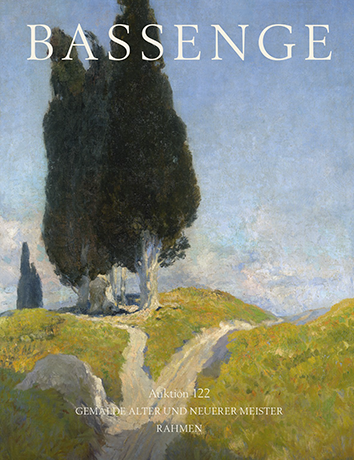
Das Los befindet sich im Archiv.
* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.
Galerie Bassenge
Erdener Str. 5A
14193 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,
Freitag, 10–16 Uhr
Telefon: +49 30 8938029-0
Fax: +49 30 8918025
E-Mail: info (at) bassenge.com
Impressum
Datenschutzerklärung
© 2024 Galerie Gerda Bassenge
Galerie Bassenge
Erdener Str. 5A
14193 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,
Freitag, 10–16 Uhr
Telefon: +49 30 8938029-0
Fax: +49 30 8918025
E-Mail: info (at) bassenge.com
Impressum
Datenschutzerklärung
© 2022 Galerie Gerda Bassenge
